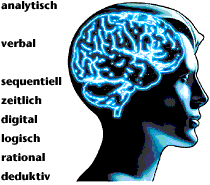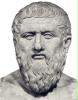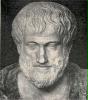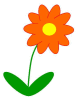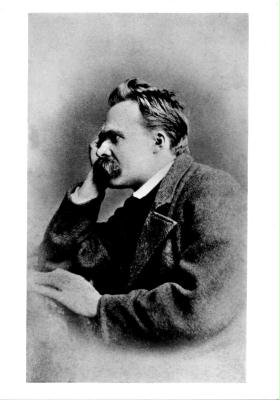Grundlagen nach
Friedrich Nietzsche:
(vgl.
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche)
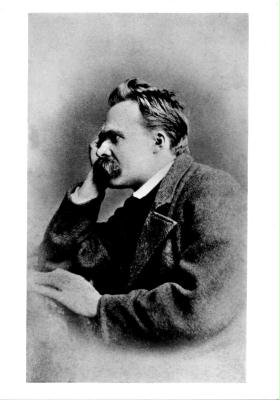
1.
Philosophie: Liebe zur Weisheit
Weisheit = Durchblick aufgrund von Erfahrungen
2.
Pädagogik: Bewusstes Handeln
Verbinden wir die
Philosophie mit der
Pädagogik ergibt sich folgendes Bild:
Wir handeln bewusst aufgrund von Durchblick.
3.
Aspekt: Wir sehen uns etwas an /betrachten den Gegenstand auf etwas hin
Theorie : Möglichkeiten sehen/ wissen, wie etwas geht
Praxis: Strategie des Umsetzen könnens
--> diese beiden Aspekte gehörten in der Vergangenheit einmal zusammen
In der Veranstaltung wurden nun eine Reihe von Behauptungen aufgestellt, die die Studenten selber testen konnten:
1. Behauptung:
Als gebrochenes, geschichtsloses Wesen verstehen Sie Ihre eigene Sprache nicht.
Test: sehen --> ansehen, besehen, einsehen, hinsehen
Wir stellen fest, dass es sehr schwer ist, die eben genannten Bergriffe sinnvoll und korrekt zuzuordnen.
2. Behauptung:
Kaum jemand ist in der Lage dies zu leisten.
Test: abstrahieren, Komplement, konkretisieren, intuitiv, Komplement, kreativ
Gebrochenheit --> viele Situatuionen ergreifen wir nicht für uns, sondern gegen uns
gebrochener Mensch --> Sport: Prinzipienreiterei
3. Behauptung:
Als gebrochenes, geschichtsloses Wesen verstehen Sie keine Begriffe.
Frage: Gibt es Begriffe, die man erklären kann mit dem Hintergrund, dass der Gesprächspartner vier Jahre alt ist?
Wir werden feststellen, dass es schwer ist, die Wortwahl so zu treffen, dass wir komplexe Zusammenhänge sinnvoll mit dem Wortschatz eines vierjährigen zu erklären.
4.Behauptung:
Als gebrochenes, geschichtsloses Wesen verfallen Sie natürlicherweise in Aberglauben, sie brauchen etwas, an dem Sie sich festhalten können.
Beispiel:
Modelle --> "Frauen verstehen nichts von Mathe"
Zusammenfassung:
Was ist Philosophie?
--> Verstehen der Sprache
--> Begreifen von Erscheinungen, vor allem von sich selbst
--> Aufgabe von Modellen (zurück zur eigenen Wirklichkeit)
Definition nach www.wikipedia.de
Definitionen, was "Philosophie" eigentlich bedeutet, gibt es beinahe so viele wie Philosophen. Dies betrifft bereits die klassischen Philosophen Athens. Ursprünglich bezog sich der Begriff "Philosophie" auf eine Denktradition, die vom antiken Griechenland ausging. Er wird heute aber auch für asiatische Denktraditionen (östliche Philosophie) und eher religiöse Weltanschauungen verwendet.
Daneben taucht der Begriff in jüngerer Zeit im Wirtschafts-Jargon und in der Technik als Synonym für Strategie oder Gesamtkonzept auf (Unternehmensphilosophie, Designphilosophie)"
Was ist Wahrnehmung?
Wahrnehmung ist nicht nur das Sehen, das unsere Sinne, sondern auch das, welches unseren Geist erfasst. Mit dem Geist können wir also Möglichkeiten erfassen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Unterscheidung von
1. Wirklichkeit
2. mögliche Wirklichkeit
3. wirkliche Möglichkeit
4. mögliche Möglichkeit
Versuchen wir nun, diese Unterscheidung mit praktischen Beispielen aus dem alltäglichen Leben zu erklären, so werden wir feststellen, dass es uns schwer fallen wird. Prinzipiell ist dies aber doch leichter möglich als man denkt, denn:
Es ist unmöglich, bzw. Aberglaube falsch zu denken, man glaubt es nur!
Rudolf Arnheim: "Sobald wir wahrenehmen, gestalten wir auch!"

"Im Mittelpunkt von Balázs’ Theorie steht der Schauspieler, eben der "sichtbare Mensch", der, weil er im Stummfilm alles mit seinem Äußeren darzustellen hat, außer Mimik und Gestik auch seine Physiognomie als Ausdrucksmittel einsetzen muß. "Denn was innen, das ist außen." - dieses Goethe-Wort findet sich nicht nur bei Balázs, sondern auch bei dem Gestaltpsychologen und Arnheim-Lehrer Wolfgang Köhler. Der Gestaltpsychologie, die den Besonderheiten der visuellen Wahrnehmung ihre Entstehung und ihre wertvollsten Gesetze verdankt, fühlt sich Arnheim bis heute verpflichtet."(http://www.sozpaed.fh-dortmund.de/diederichs/texte/arnheimb.htm)
Ich denke, damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass wir andere nicht nur anhand dessen was sie sagen , sondern auch, oder in manchen Fällen sogar noch eher anhand ihrer Gesichtszüge verstehen können. Das heißt im Bezug auf Arnheims Satz "Sobald wir wahrnehmen, gestalten wir auch", dass, wenn wir beispielsweise einen Menschen mit verzogenem oder genauer gesagt zusammengezogenem Gesicht, sprich zusammengekniffenen Augen und ähnlichem, sehen, davon ausgehen können, dass dieser nicht sonderlich glücklich ist. Wir brauchen also keine Worte, um dies zu erkennen, sondern können aufgrund unserer Erfahrungen Bilder zuordnen.
Nummer3 - 16. Mai, 16:20
 Nach Sokrates lässt sich jeder Mensch von seiner inneren Stimme, dem so genannten Daimonion leiten. Dieses warnt uns in vielerlei Situationen und schützt uns somit.
Nach Sokrates lässt sich jeder Mensch von seiner inneren Stimme, dem so genannten Daimonion leiten. Dieses warnt uns in vielerlei Situationen und schützt uns somit.